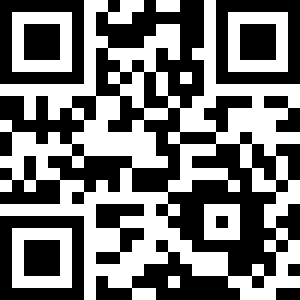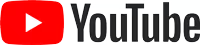Falsche Versprechungen im Internet mit Coaching-Urteil des OLG Celle?

Teils unrichtige und undifferenzierte Werbeaussagen zum Coaching-Urteil
Im Internet verbreiten sich derzeit diverse Werbeartikel von Anwaltskanzleien zu einem Urteil des OLG Celle vom 1.3.2023 (Az. 3 U 85/22). In einigen dieser Artikel wird gezielt der Eindruck vermittelt dass Coaching-Kunden die Möglichkeit hätten, die Vergütung eines längst absolvierten Coachings im Nachgang vom Anbieter wieder herausverlangen zu können, weil ein Coaching-Anbieter möglicherweise Fernunterricht nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG) angeboten hätte, ohne die dafür erforderliche Zertifizierung zu besitzen. Eine solche Annahme ist jedoch ausweislich des Celler Urteils gänzlich falsch und kann zu einem teuren Missverständnis führen.
In vielen Werbeartikeln wird außerdem die Tatsache verschwiegen, dass das Celler Urteil noch nicht einmal rechtskräftig ist. Das Urteil liegt zwischenzeitlich dem Bundesgerichtshof (BGH) im Wege der Revision zur Überprüfung vor. Nicht ausgeschlossen, dass die Karlsruher Richter zu einer gänzlich anderen Bewertung gelangen werden als das OLG Celle.
Nichtigkeit eines Fernunterrichtsvertrags bei fehlender Zertifizierung
Nach § 7 Abs. 1 des FernUSG ist ein Fernunterrichtsvertrag nichtig, wenn es sich dabei um einen Fernlerngang handelt, dem nicht eine gemäß § 12 des FernUSG erforderliche Zulassung der zuständigen Behörde zugrunde liegt. An dieser Stelle kommt es zur ersten Problemstellung, die in den angesprochenen Werbeartikeln gerne unerwähnt bleibt. Denn nicht jeder Coaching-Vertrag ist zugleich ein Fernunterrichtsvertrag. Die Voraussetzungen eines Fernunterrichtsvertrags werden in § 1 FernUSG aufgezählt. Erforderlich gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 FernUSG ist stets, dass Lehrende und Lernende beim Fernunterrichtsvertrag ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt sind. Auf viele Coaching-Angebote trifft bereits diese Voraussetzung nicht zu. Denn es ist anerkannt, dass zum Beispiel Live-Calls mittels Zoom keine räumliche Trennung im Sinne der Vorschrift sind, sondern eine synchrone, direkte Kommunikation zwischen Anbietern und Lehrenden. In diesen Fällen findet das FernUSG keine Anwendung. Man wird im Einzelfall genau hinsehen und vortragen müssen, ob sich aus dem jeweiligen Coaching-Angebot eine jedenfalls überwiegende räumliche Trennung ableiten lässt oder nicht.
Die Anwendung des Bereicherungsrechts beim nichtigen Coachingvertrag
Aber selbst ein nichtiger Vertrag ist kein Automatismus, vom Coaching-Anbieter die gesamte gezahlte Vergütung zurückfordern zu können. Ein Beispiel:
Angenommen Coaching-Kunde A hat ein Coaching bei Coaching-Anbieter B gebucht, bei dem sich zugleich um einen Fernunterrichtsvertrag im Sinne des § 1 FernUSG handelt. Anbieter A besitzt keine Zertifizierung nach § 12 FernUSG, so dass der geschlossene Vertrag gemäß § 7 FernUSG nichtig ist. Kann Kunde A dann ohne weiteres dann ohne weiteres eine bereits entrichtete Vergütung vom Anbieter herausverlangen wegen der Nichtigkeit des Vertrags?
Hier hängt die richtige Beantwortung davon ab, ob Kunde A denn bereits Leistungen von Anbieter B in Anspruch genommen hatte. Wenn dies der Fall gewesen ist, erhält Kunde A zwar seine Vergütung für Coaching zurück, muss dem Coachinganbieter aber spiegelbildlich Wertersatz für die in Anspruch genommenen und erhaltenen Coachingleistungen bezahlen. Hier kommt es auf den üblichen Marktpreis für die gebuchten Leistungen an. Wenn der vereinbarte Preis für das Coaching marktüblich gewesen ist, dann wird der entsprechende Preis auch bei einer Nichtigkeit des Vertrags an den Coachinganbieter zurückzuführen sein. Ein Nullsummenspiel im Ergebnis. Die Verpflichtung zum Wertersatz beim nichtigen Vertrag folgt aus den §§ 812 ff. BGB. Das ist dann noch nicht einmal eine Spezialität eines Coaching-Vertrags, sondern Jura erstes Semester.
Im schlimmsten Fall gilt: außer Spesen nichts gewesen, Anwaltskosten on top
Sind Sie Coaching-Anbieter und mit Rückforderungen ehemaliger Coaching-Kunden konfrontiert? Lassen Sie sich nicht verunsichern. Denn im (nicht rechtskräftigen) Urteil des OLG Celle vom 1.3.2023 ist sogar schwarz auf weiß ausformuliert, dass vorhandene Wertersatzansprüche des Coaching-Anbieters berücksichtigt werden müssen. Das OLG weist nämlich im Urteil auf die Anwendbarkeit der bereicherungsrechtlichen Vorschrift des § 812 BGB hin. In dem Fall, den das OLG Celle beurteilen musste, hatte das Coaching noch nicht begonnen und der Kunde keine Leistungen des Anbieters in Anspruch genommen. Sobald dies aber der Fall ist und der Vertrag tatsächlich wegen fehlender Zertifizierung nichtig sein sollte, greifen aber die Vorschriften der §§ 812 ff. BGB. Die derzeit kursierenden Werbeartikel im Internet sind daher mit äußerster Vorsicht zu genießen. Dem Coaching-Kunden wäre nicht geholfen einen Prozess anzustrengen an dessen Ende ein Nullsummenspiel steht, weil er oder sie dem jeweiligen Coachinganbieter dann selbst Wertersatz zu leisten hätte und es hieße: Wie gewonnen, so zerronnen. Die Profiteure wären die wohl bewusst missverständlich werbenden Kanzleien, die natürlich unabhängig vom Ausgang eines Rechtsstreits bezahlt werden müssen. Schlimmstenfalls trägt ein klagender Coachee dann seine eigenen Anwaltskosten auch noch und die Gegners.